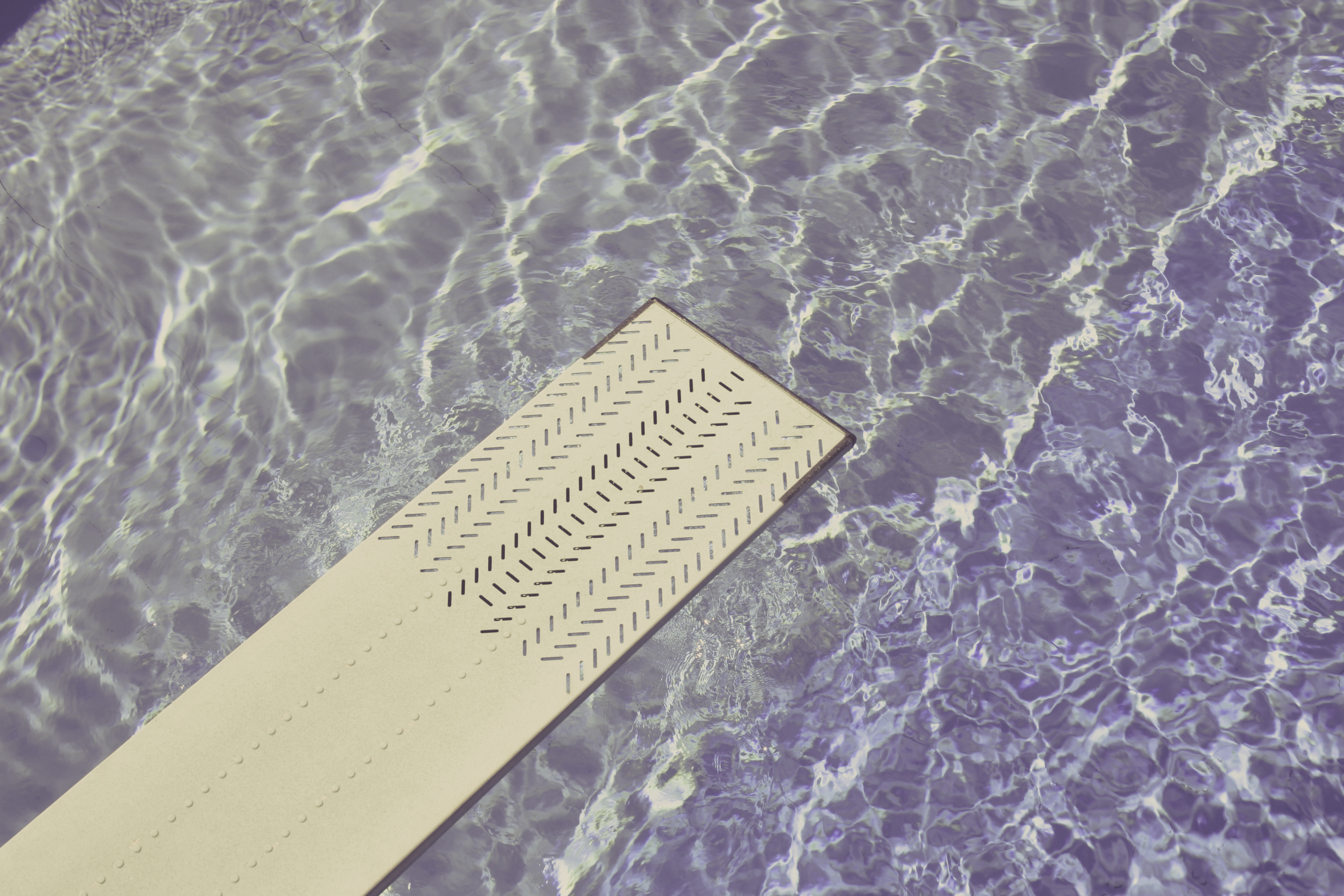Nachtschicht auf dem Rettungswagen, gegen halb zwölf ruft uns der Melder zu einem Notfalleinsatz. Ein gestürzter Mann auf der Straße – die Passant*innen, die den Herrn umsorgend versuchen in der stabilen Seitenlage zu halten, berichten, er sei umgefallen wie ein Brett. – Kein Wunder, denn die zwölf großen Bier, von denen er berichtet, gingen nicht spurlos vorbei.
Es ist ein Klassiker: ein wohnungsloser Mann, nur einige Jahre älter als ich, nach einem Streit mit Verwandten hat er seinen Frust kräftig im Hopfensaft ertränkt. Während unserer Versorgung wiederholt er seine Fragen, und schildert seine Eindrücke von dieser Welt und seinem Leben. Die Situation – in einem Rettungswagen liegend und nicht mehr wissend, was geschah – kränkt ihn, ist ihm peinlich. Er weint. Ich hoffe, dass das Wechselbad der Gefühle nicht in Aggression umschlägt, wie es auch durchaus mal vorkommt. Klientelpolitik, bei der ich mich selbst erwische, da sie keinerlei Relevanz für die Versorgung und die Situation hat.
Wir reden ihm gut zu, wiederholen geduldig, fast mantraartig unsere Maßnahmen und unsere nächsten Schritte. „Ein Freund bleibt ein Freund“, sagt er immer wieder. Er glaubt, wir seien uns schon mal begegnet und fantasiert mich in abstruse Situationen seines Lebens.
In der Klinik hockt er in der Notaufnahme auf einer Trage und ruft mich zu sich, er bietet mir den Platz neben sich an, den ich etwas zurückhaltend doch einnehme. Dann stützt er sich mit dem Arm auf meiner Schulter ab und erklärt mir noch einmal „ein Freund bleibt ein Freund“ und bedankt sich per Handschlag für unsere Versorgung. Für die Klinik-Kolleg*innen ein etwas seltsames Bild: der rot-blau leuchtende Uniformträger nebst der Alkoholfahne, die wie zwei Freunde auf einer Mauer sitzen und über das Leben sinnieren. Einerseits mag ich diese Nähe nicht mit diesem fremden Menschen, andererseits sehe ich, dass es ihm gut tut – und mir nicht weh.
Für mich eine kurze Begegnung, eine Mission, die mir wieder einmal zeigt wie die in unserer Gesellschaft, in unseren Vorurteilen, in unserer Welt untergehen, die wenig bis nichts haben. Ihre Wünsche nach einem „normalen“ Leben, nach verlässlichen Freund*innen – wer kennt sie nicht? Ich wünsche, er findet ihn*sie: der*die Freund*in, der*die ein*e Freund*in bleibt.