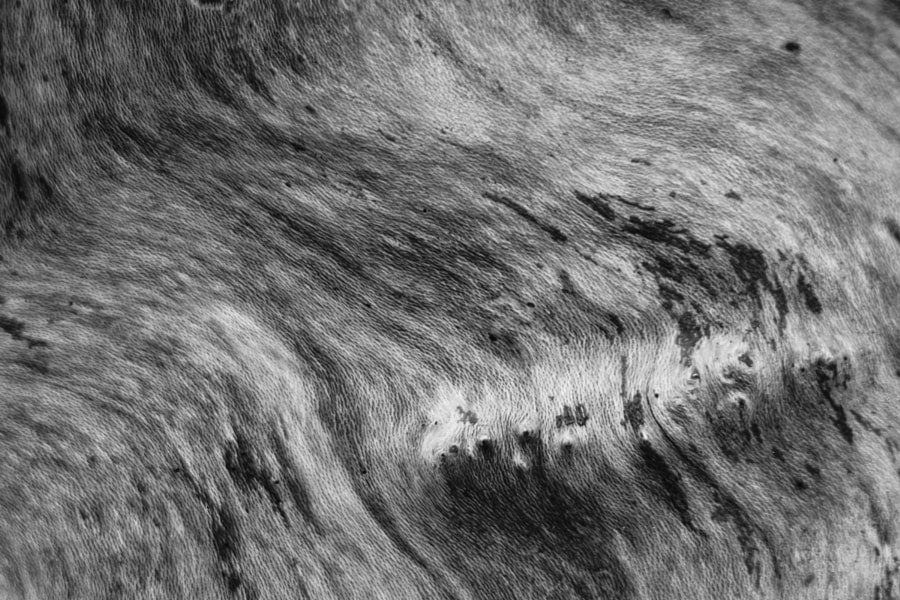Wenn es regnet, jogge ich immer nur im Kreis.
Ich laufe zu einem Parkplatz, der gerade mal 50 Meter von meiner WG entfernt ist; Runde um Runde. Ich gucke auf den Boden und habe eine Kapuze auf.
Ich mache das, damit ich, falls es mir zu nass oder zu kalt wird, schnell wieder nach Hause kann.
Ich wohne in einer schönen Stadt. Es gibt einen Park, einen Fluss mit Enten darauf und einen kleinen Wald. Aber wenn es regnet, gibt es für mich nur den Parkplatz und den Blick auf meine Laufschuhe. Manchmal frag ich mich, was das über mich aussagt. Was denken andere Leute, wenn sie mich immer im Kreis laufen sehen? Was denke ich da über mich? Bin ich zu ängstlich? Scheue ich das Risiko? Vermutlich von allem ein Bisschen. Aber egal was ist, irgendwie wünsche ich mir immer mehr als meine Runde, auch im Regen, auch in der Kälte, auch in Trauer, auch in Einsamkeit.
Eigentlich wünsch ich mir, dass ich mich traue meine Kapuze zurückzuschlagen, die kalten Tropfen auf meinem Gesicht zu spüren, zu dem Fluss zu laufen, mir die Enten anzuschauen, denen der Regen auch nichts ausmacht, lachend nach Hause zu laufen und zu wissen, dass sich das Neue gelohnt hat.
Gestern hat es nicht geklappt, aber ich glaube jetzt, da ich weiß, dass ich es will, kann ich es auch.