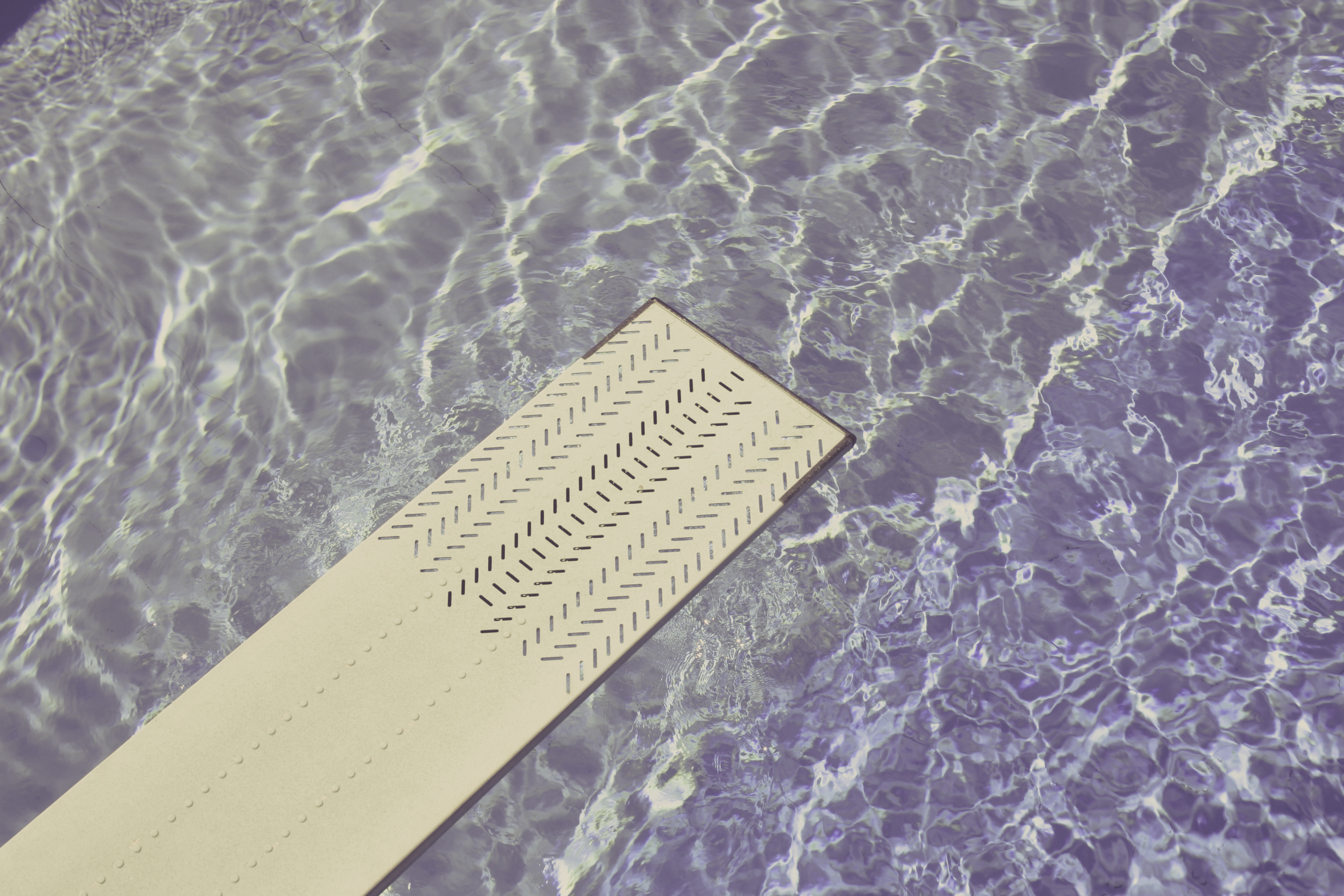Und da ist er wieder, der Advent.
Auch wenn ich mich dem allgemeinen Weihnachtsstress nicht entziehen kann, genieße ich diese Zeit doch sehr.
Aber leider fehlt mir etwas sehr Entscheidendes und es fehlt bereits seit 14 Jahren. Vor 14 Jahren habe ich zum ersten Mal den Advent und Weihnachten ohne meine Oma verbracht. Sie ist zwei Monate vorher mit fast 91 Jahren gestorben und dieses Jahr muss ich besonders oft an sie denken.
Meine Oma war die beste Oma der Welt. Punkt.
Wenn ich bei ihr war, gab es nichts, was mir gefehlt hätte. Sie war die Geduld in Person, sie hat nie geklagt, nie gejammert, nie geschimpft und nie über andere Menschen schlecht geredet. Schon gar nicht über mich.
Sie gab mir stets das Gefühl, etwas Besonderes zu sein, einfach nur, weil ich ich war.
Diese Frau, die 1912 geboren wurde, beide Weltkriege erlebt, einen Bruder an einen der Kriege, zwei ihrer Kinder an die mangelnde medizinische Versorgung der Kriegs- und Nachkriegszeit und ihren Mann schließlich an Krebs verloren hat. Diese Frau, die selbst die letzten 14 Jahre ihres Lebens schwer krank war, hat immer gelächelt, wenn sie mich angesehen hat.
In ihrer Nähe fühlte ich mich immer vollständig angenommen.
Mittlerweile ahne ich, dass nicht viele Menschen einem im Laufe eines Lebens ein solches Gefühl vermitteln.
Ich weiß, sie könnte heute gar nicht mehr leben. Sie wäre 105 Jahre alt. Und doch stelle ich es mir gerne vor, wie es wäre, wenn sie nur diesen Advent und diese Weihnachtszeit noch einmal mit uns verbringen könnte.
Noch einmal würde ich einen ganzen Nachmittag bei ihr im Wohnzimmer sitzen und wir würden gemeinsam stricken.
Noch einmal würden wir an einem Adventssonntag alle drei „Sissi“-Filme schauen und es würde nach frischem Kuchen und Filterkaffee riechen.
Noch einmal würden wir nach der Christmette alle gemeinsam Weihnachtslieder singen und mein Bruder und ich würden noch einmal darüber kichern, dass sie kaum einen richtigen Ton mehr trifft.
Noch einmal würde ich ihren Geschichten aus vergangenen Tagen lauschen und den Glanz in ihren Augen sehen, wenn sie von all den Menschen erzählt, die schon so lange nicht mehr da sind.
Und dieses Mal würde ich ihr, bevor sie geht, wirklich sagen, wie viel sie mir bedeutet hat.