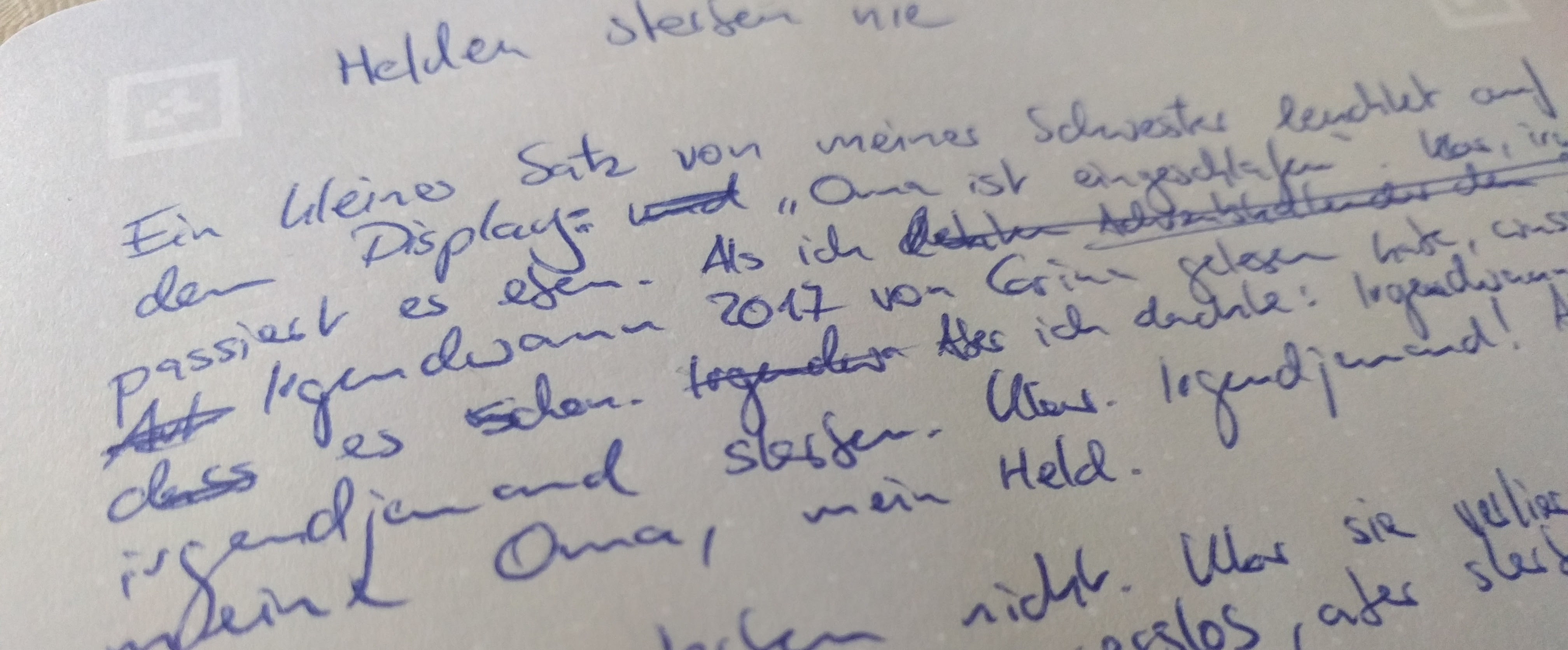Zugegeben, ich bin ja schon ein kleiner Liturgienarr. Wenn die Orgel feierlich ertönt, Weihrauch geschwungen und dann vielleicht auch noch ein feierliches Lied gesungen wird, geht mir das schon sehr nah und erfüllt mich.
So trage ich auch schon seit einiger Zeit die Vorstellung mit mir herum, einmal am Hochfest Epiphanie im Kölner Dom zu sein. Das Hochfest der heiligen drei Könige an den Gebeinen der heiligen drei Könige im Dom zu feiern ist sicherlich etwas Besonderes. Wenn dann auch noch „Adeste Fideles“ – „Nun freut euch ihr Christen“ – gesungen werden würde, ja, dann wäre das sicherlich für mich ein tief anrührender und erfüllender Moment, der unter die Haut geht.
„Nun freut euch, ihr Christen, singet Jubellieder
und kommet, o kommet nach Bethlehem.
Christus, der Heiland, stieg zu uns hernieder.
Kommt, lasset uns anbeten; Kommt, lasset uns anbeten;
Kommt, lasset uns anbeten den König, den Herrn.“
Das Epiphaniefest habe ich dieses Jahr allerdings ganz anders gefeiert. Ich befinde mich zurzeit in Kenia und habe hier an einer Messe mit einer Gemeinde tief im Landesinneren teilgenommen.
Jeden Sonntag wird dort der Gottesdienst direkt zum Sonnenaufgang um 06:20 Uhr gefeiert. Warum? Vor sechs Jahren haben die Gemeindemitglieder begonnen eine Kirche zu bauen. Seit fünf Jahren liegt diese Baustelle brach. Es ist schlicht kein Geld da, um die Kirche fertig – oder überhaupt weiterzubauen. Dem Kirchbau fehlt es an allem und eben auch an einem Dach. Sobald die Sonne aufgeht wird es sehr heiß und ohne den Schatten, den ein Dach spenden könnte, ist die Hitze kaum zu ertragen.
Keine Orgel, kein Weihrauch, kein Strom, ja nicht mal ein Dach ist vorhanden;
das trifft nicht gerade die Vorstellung, die ich bisher mit dem Epiphaniefest verbunden habe.
Im Nachhinein muss ich sagen, ich hätte ich mir die Feier dieses Festes kaum schöner vorstellen können. Vielleicht lässt sich diese Liturgie mit dem Adjektiv „ehrlich“ am besten beschreiben. Es fanden sich so viele Gläubige ein: Menschen, die ein sehr einfaches Leben führen, Junge wie Alte, Arme und Kranke, die sich trotz dieser widrigen Umstände jeden Sonntag auf einen teilweise langen Fußweg durch die Dunkelheit machen um am Gottesdienst in ihrer „Kirche“ teilnehmen zu können.
Die Menschen hier sprechen weder Kisuaheli noch Englisch, sondern einen Stammesdialekt, der Kiluyha heißt. So habe ich wirklich kein einziges Wort in der Messe verstanden.
Aber als sich zur Kommunion ein alter Mann mit einem Bein und ziemlich zerrissener Kleidung, gestützt auf einen Stock nach vorne kämpfte, kam mir nochmal „Adeste Fideles“ in den Sinn.
„Nun freut euch, ihr Christen, singet Jubellieder
und kommet, o kommet nach Bethlehem.
Christus, der Heiland, stieg zu uns hernieder.
Kommt, lasset uns anbeten; Kommt, lasset uns anbeten;
Kommt, lasset uns anbeten den König, den Herrn.“
Irgendwie waren wir genau in dieser Messe tatsächlich angekommen. Zusammen waren wir im Stall von Bethlehem.
Dann kamen mir die Tränen.