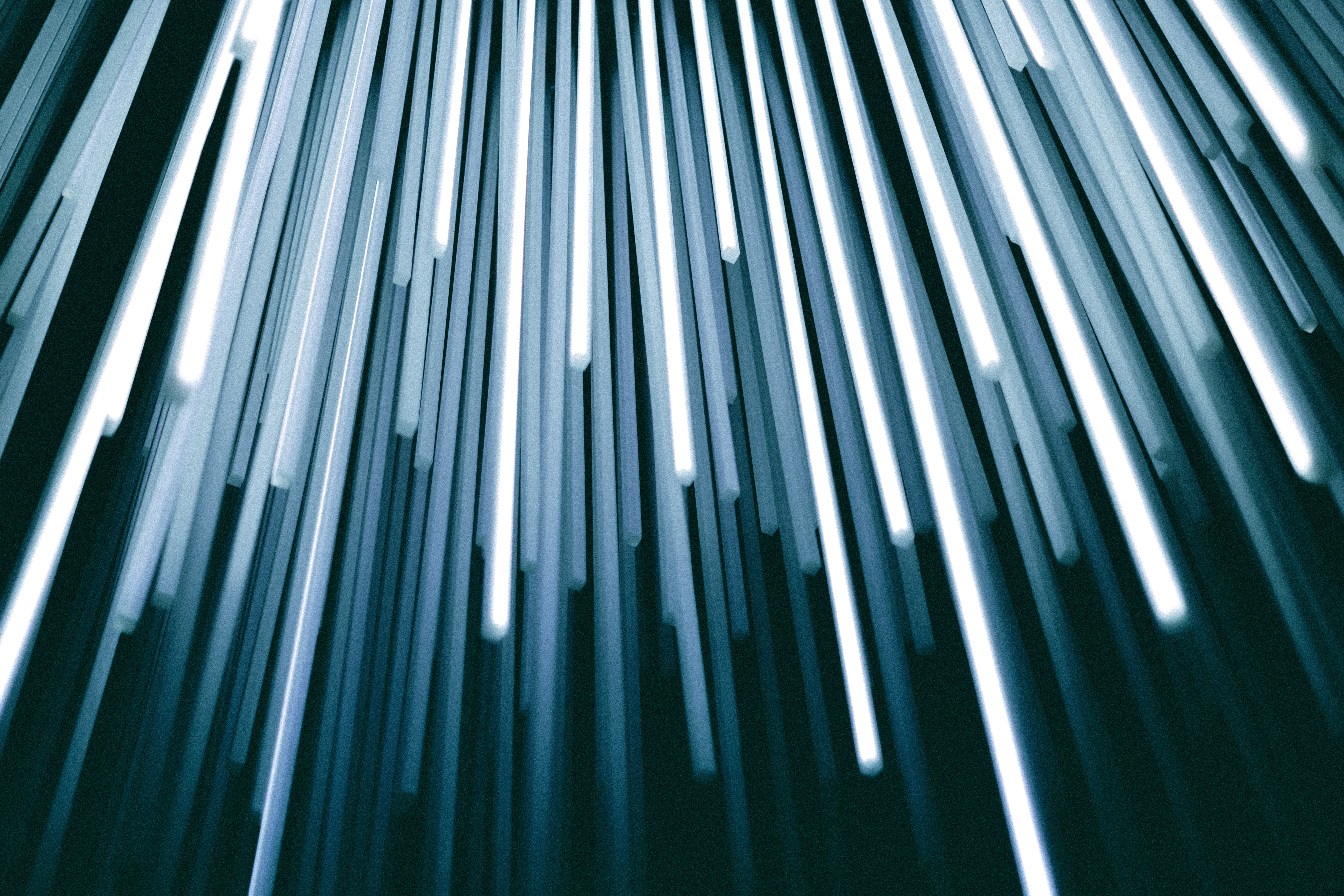Bis zu meinem 16. Lebensjahr habe ich Fußball gespielt. Zugegebenermaßen war das nie von sonderlich viel Erfolg gekennzeichnet, im Gegenteil. Ich war der Spieler, der seinen Platz auf der Ersatzbank nur dann aufgeben musste, wenn nicht genügend Mitspieler zum Spiel da waren. Kam es einmal zu dieser Katastrophe, galt die Devise möglichst den Ball zu meiden, dafür aber mit selbstbewussten Antritten und Laufwegen den Gegner zu verwirren, um so Räume für die eigenen Mitspieler zu schaffen. Meistens ist diese Taktik nach zwei Minuten aber aufgefallen, sodass ich den Rest der Zeit mit sinnlosem Hin- und Herlaufen verbracht habe.
So galt es die Spielzeit bis zur Halbzeitpause totzuschlagen. Diese schöne Zeit, die man in der Kabine verbringt, ohne die Sorge zu haben, mit weiteren Peinlichkeiten auf dem Platz aufzufallen.
Halbzeit. Eine wunderbare Zeit. Dabei war die Kabine unter den Maßstäben eines geschlossenen Raumes meist mindestens genauso hässlich wie mein Fußballspiel; zu klein, zu kalt, zu stinkend. Aber sie wurde zum Sehnsuchtsort, weil das Spielen meist noch schlimmer war.
Heute hat der Advent Halbzeit. Vieles habe ich mir für diese Zeit vorgenommen. Die Zeit etwas bewusster gestalten, mehr Zeit für mich und das Gebet nehmen, sozial aktiver sein, auf andere Menschen mehr Rücksicht nehmen. Vieles davon ist bisher etwa so erfolgreich gelaufen wie mein Fußballspiel. Leider ist der Advent auf den ersten Blick unbarmherziger als ein Fußballspiel. Es gibt keine Kabine, keine Halbzeitpause.
Aber dafür gibt es etwas anderes: Die Hoffnung, dass das alles nicht so aussichtslos ist wie mein Versuch, Fußball zu spielen. Ich will hoch von der Ersatzbank meines immer wieder zu trägen Menschseins, ich will raus auf den Platz.