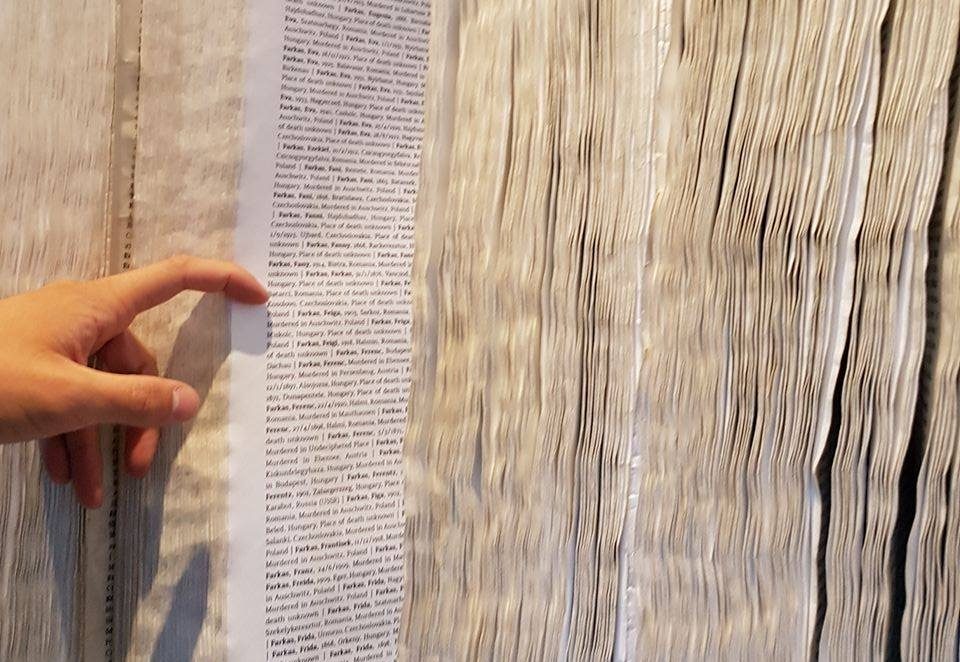Es ist noch dunkel im Zimmer. Der Wecker – zum zweiten Mal – vertröstet. Noch fünf Minuten. Bitte! Ein paar Sonnenstrahlen, die sich zwischen Kleiderschrank und Vorhang durchzwängen, lassen einen heißen Tag erahnen. Ein letzter Sommertag.
Mein Handy klingelt. Papa meint das Display. Papa? frage ich mich. „Papa?“ frage ich in den Hörer. So früh? Naja, acht. „Sitzt du?“ Nein, ich liege noch. Noch fünf Minuten. Bitte! „Es ist was Schreckliches passiert.“ Was Schreckliches? So redest du sonst doch nicht? Dann sagt er einen Namen. Dann etwas Unmögliches. Etwas Undenkbares. Was Schreckliches.
Eine Bekannte meiner Eltern. Eine ihrer Trauzeuginnen. Mehr: eine Freundin der Familie.
Mehr: eine neunundvierzigjährige Mutter einer kleinen Tochter. Neun vielleicht. Neun. Und. Vierzig. Eine Ehefrau. Eine Tochter. Eine Schwester. Eine, die immer fragt. Wie es ist. Wie es geht. Vor drei Wochen hat sie mir noch einen Espresso gekocht. Was Schreckliches.
„Scheiße.“, sage ich in den Hörer. „Scheiße“. Mehr kann ich nicht sagen. Mehr kann ich nicht denken. Und – eingekocht in ein fünf Buchstaben großes Klischee – die eine Frage, die nicht gestellt werden kann, geschweige denn beantwortet: Warum? Warum jetzt? Warum sie? Warum?
Irgendwie kam ich dann doch zum Fenster. Vorhang auf: Ein letzter Sommertag.
Morgens kurz ins Büro. Ging alles irgendwie. Irgendwie normal. Ging alles irgendwie gut.
Für den Nachmittag hatte sich schon länger Besuch angemeldet. Gemeinsames Kochen. Gemeinsames Schwitzen beim Spazieren. Gemeinsamer Blick in die Weite und zwischen alledem immer wieder ein Thema. Was Schreckliches. Und ein Wort. Scheiße.
Meine Ohren klingeln. Zwei Wörter sind zu wenig, ein Wort ist zu viel. Alles, was gesagt wird, und was gesagt werden wird, steht dem Nichts gegenüber, was gesagt werden kann. Gemeinsamer Blick in die Weite. In das blaue weite Nichts. Ein Blick nach oben – wohin ist doch egal, hast du uns das nicht so gesagt? Dass du da bist? – eine Frage nach oben: Warum? Warum jetzt? Warum sie? Warum?
Die Sonne scheint. Keine Wolke. Etwas Wind. Ein letzter Sommertag.
Gegen Abend verabschieden wir uns. „Schön, dass ihr da wart.“ Schön, dass ihr da wart. Gut, dass ihr da wart. Und dann, die Tür ist zu, die Klinke noch in meiner Hand, ein Lächeln. Ein Lächeln, irgendwie echter als jedes andere an diesem dann doch irgendwie normalen Tag. Warum? Das wird sich mir nicht erschließen, vermutlich nicht. Aber dass du da bist, habe ich irgendwie verstanden, auch wenn ich auf diese Erfahrung so gut und gerne hätte verzichten können. Scheiße. Schön, dass ihr da wart. Gut, dass ihr da wart.
Weil ich das Lächeln, allein in meiner Wohnung, unpassend finde, höre ich wieder auf damit. Komme wieder zu dem einen Wort zurück, das diesen Tag so schrecklich treffend durchzieht: Scheiße.
Ich bleibe am Kalender hängen. Ein Abreißkalender, dessen Blätter ich in einen kleinen Karton stecke, wenn ihre Tage gezählt sind. Montag. August. Einunddreißig.
Der letzte Sommertag.