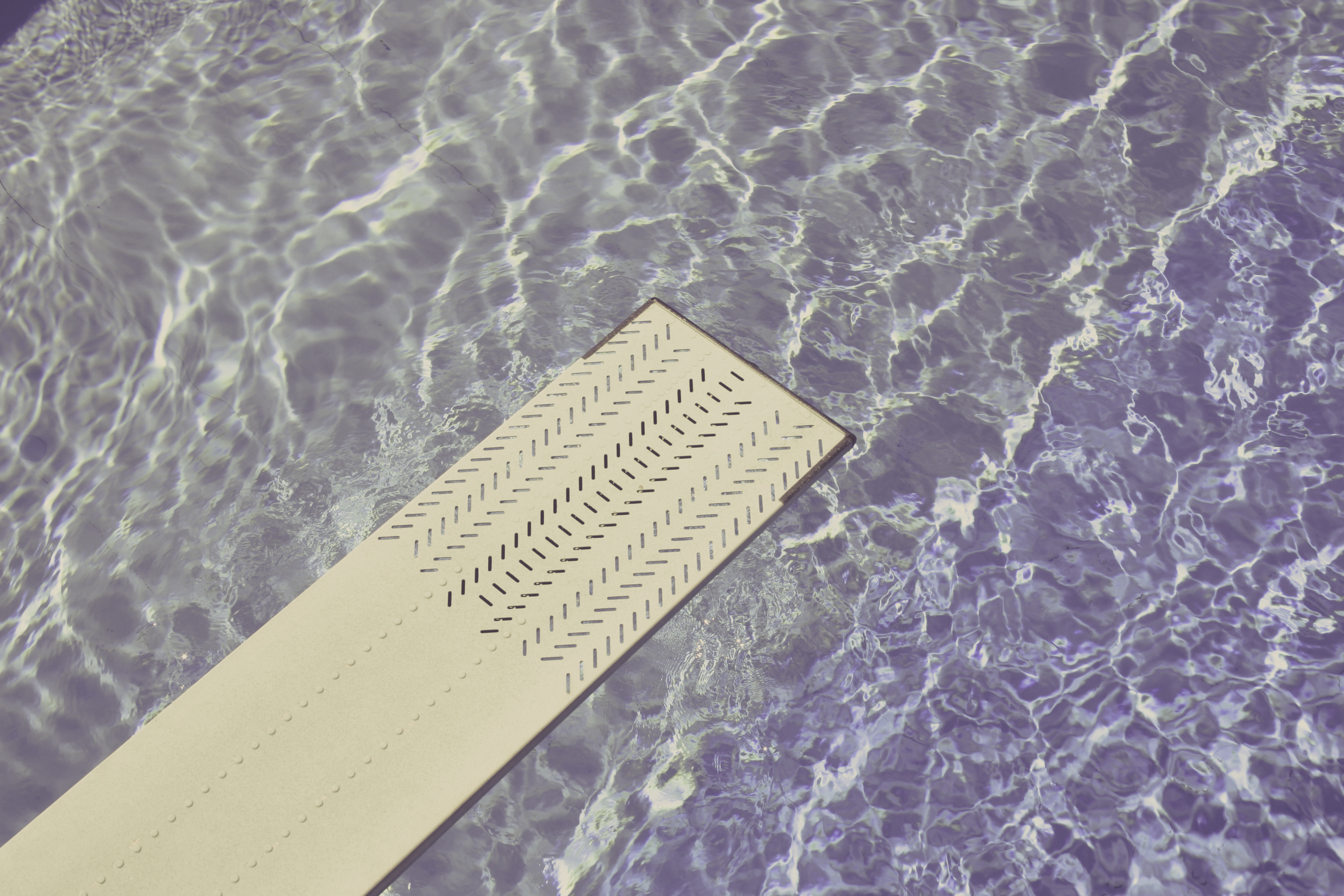Auf dem Boden liegen Tote, in der Luft Tränengas, in der Luft Tränengas.
Ich bin noch gar nicht richtig hier, schon sterben Menschen neben mir…
2015 habe ich zum ersten Mal „Feine Sahne Fischfilet“ live gesehen. Entstanden ist dabei zwischen ihrer Musik und meinem Herz für deutsche Punkmusik eine innige Liebesbeziehung, die in vielen wilden Konzerten mündete.
Zwei Straßen weiter spielen Kinder. In der Stadt riecht es nach Blut. Überall riecht es nach Blut.
Nur wenige Tage nach meinem ersten Konzert ist der Sänger der Band, Monchi, mit einer Hilfsorganisation in die türkisch-syrische Grenzstadt Suruc gereist. Sie wollten Hilfsgüter in die benachbarte und vom IS besetzte Stadt Kobane bringen.
Samstag noch im Rampenlicht. Jetzt steh‘ ich hier und schäme mich. Bald bin ich wieder Zuhaus‘. Sag‘, wie haltet ihr das aus?
Dort entgingen sie selbst nur knapp einem verheerenden Anschlag von Terrorist*innen des IS. Im gleichnamigen Lied Suruc werden die Erfahrungen dieser Stunden verarbeitet, für mich das emotionalste Lied des neuen Albums.
Die Verzweiflung trübt die Sicht. Unsere Tränen kriegt ihr nicht.
Denn das Lied bleibt nicht in der Verzweiflung stehen. Der Refrain berichtet von einer Demonstration der Einwohner*innen am nächsten Tag. Dort wurde ein Plakat gezeigt mit der Aufschrift: „Wir haben’s verteidigt – bauen’s gemeinsam wieder auf!“
Menschen, die schon lange vorher regelmäßig vom IS drangsaliert wurden, nehmen eine Tragödie hin. Nicht mit Hass. Nicht mit Gegengewalt. Nicht mit innerer Verbitterung.
Wir haben’s verteidigt, bauen’s gemeinsam wieder auf!
Es bleibt dabei – du wirst nie verlieren, solang ihr an euch glaubt!
Diese Menschen sind für mich Vorbilder! Vieles droht zusammenzubrechen. Vieles ist zusammengebrochen. Vieles muss wieder aufgebaut werden. Vieles wird wieder aufzubauen sein. In meinem privaten Leben wie in unserer Gesellschaft. Ich will nicht darüber klagen, ich will nicht weinen. Ich will verteidigen und aufbauen und ich weiß genau, ich werde nicht verlieren, solange ich an all das glaube, wofür ich einstehe.
Vor einigen Tagen habe ich Feine Sahne Fischfilet mal wieder live gesehen. Nie habe ich eine Zeile bei einem Konzert so mitgeschrien wie diese: „Wir haben´s verteidigt, bauen´s gemeinsam wiederauf!“