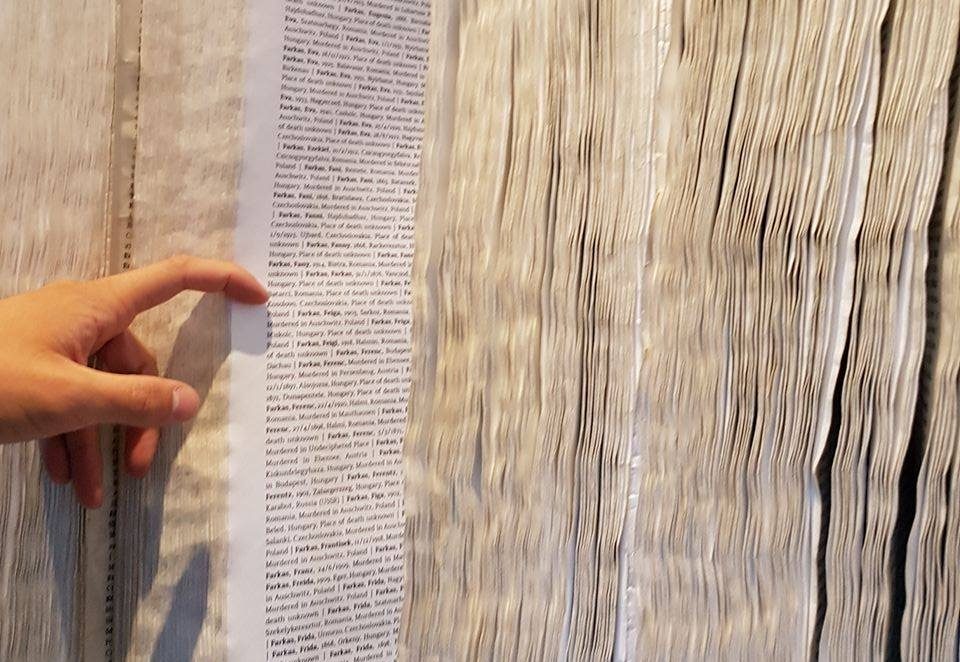Ein Buch, in das ich Jahre nicht mehr reingeschaut habe.
Ein Bilderrahmen, der seinen Platz auf dem Kleiderschrank gefunden hat und erstmal abgestaubt werden musste, damit das gerahmte Bild überhaupt zu erkennen war.
Eine alte Tasse, aus der ich eigentlich noch nie getrunken habe.
Eine Urlaubspostkarte von einer Freundin aus Schulzeiten, von der ich mittlerweile nicht mal mehr weiß, in welcher Stadt sie lebt.
Ein Kugelschreiber aus einem Urlaub, der seit Jahren nicht mehr schreibt, aber dennoch seinen Platz auf meinem Schreibtisch hat.
Ein T-Shirt, das an meinen Abiturjahrgang erinnert, das ich nach fünf Jahren Studium und Mensa aber maximal noch bauchfrei tragen könnte.
All diese und viele weitere Dinge habe ich in meiner Wohnung gefunden.
All diese und viele weitere Dinge habe ich im Grunde jeden Tag angesehen, rumgeräumt, bei Seite geschoben und dann doch wieder hervorgeholt. Ich habe all diese und viele weitere Dinge nie weggeworfen. Ich habe immer geglaubt, all diese und viele weitere Dinge gehören halt irgendwie dazu.
Nun stand ein Umzug an.
Ich lebe jetzt in einer neuen Wohnung. Ohne das Buch, in das ich Jahre nicht mehr reingeschaut habe; ohne den Bilderrahmen, die alte Tasse und die Urlaubspostkarte. Auch ohne den Kugelschreiber. Das Abi-Shirt liegt bereit für die nächste Altkleidersammlung.
Verrückt, aber ich fühle mich wunderbar und heimisch wie nie in der neuen Wohnung.
All diese und viele weitere Dinge habe ich eigentlich nicht mehr gebraucht.
Vielleicht sollte ich einfach öfter mal umziehen und Dinge auf den Prüfstand stellen.
Einfach mal öfter Abschied nehmen und Platz für Neues schaffen.