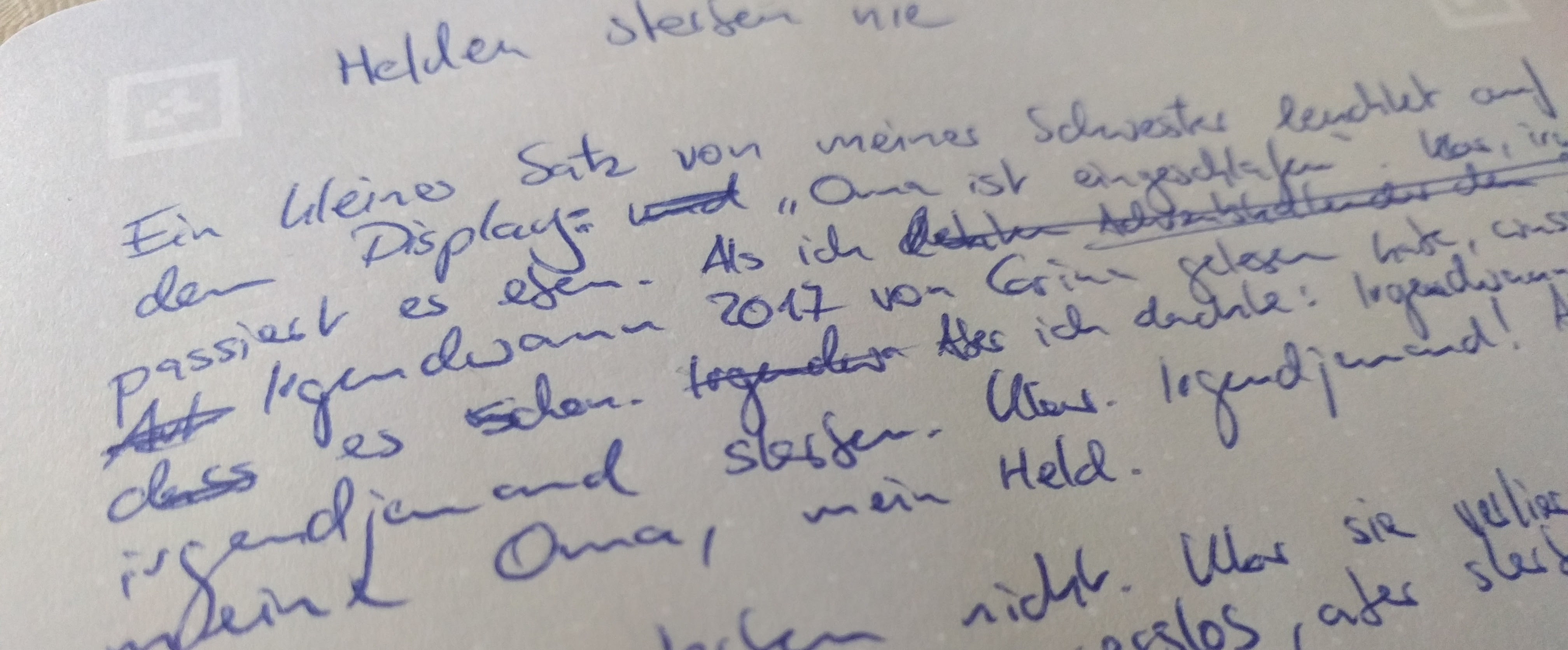Dunkelheit. Wenige flackernde Lichter. Ich sitze auf einer Bank. Meine Gedanken kreisen.
„Du schaffst das!“ „Halte durch!“ „Du bist so kurz vor der Ziellinie, los, komm schon!“
Was, wenn ich es nicht schaffen will? Was, wenn ich entscheide aufzugeben? Ständig scheint mein Umfeld zu schreien, du brauchst mehr, mehr Arbeit, mehr Geld, mehr Mode, mehr Freund*innen, mehr Connections, mehr Events, mehr Leben.
Ich bin voll. Mein Maß ist voll – nein es ist übervoll. Seit Monaten ist es übervoll.
Und ich frage mich, wo ist eigentlich ein Platz fürs Scheitern? Fürs Aufgeben? Für unerfüllte Pläne? Für nie wahrgewordene Hoffnungen und Wünsche? Solche Geschichten möchte eigentlich niemand hören. Vielleicht wegen der Angst vor den Gefühlen, die sich dann einstellen. Leere, Trauer, Einsamkeit.
Auf meiner Bank laufen mir ein paar Tränen die Wange herunter. In den Schmerz mischt sich aber auch eine tröstliche Erkenntnis. Ich bin angenommen, genauso wie ich bin. Ich muss nichts leisten, nichts besitzen, nichts vollbringen, ich reiche aus, genauso wie ich gerade hier bin. Manchmal kann ich diese Botschaft nicht nur denken, sondern auch fühlen. Ein Weihnachtsgefühl. Mein Weihnachtsgefühl. Schon heute.